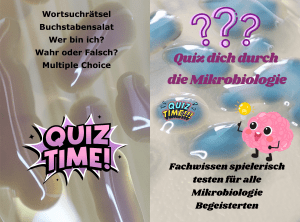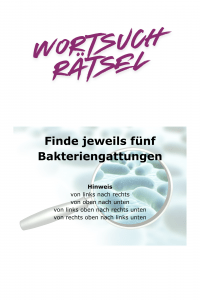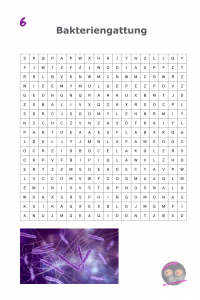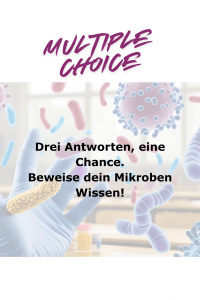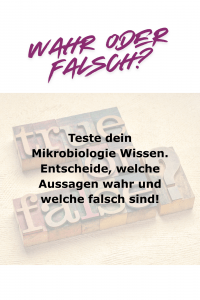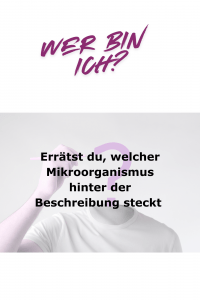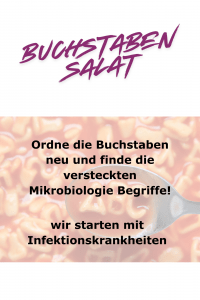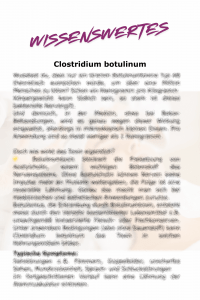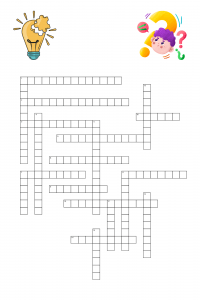Blutagar einfach erklärt – Aufbau, Hämolyse und Anwendung in der medizinischen Mikrobiologie
Blutagar ist eines der wichtigsten Nährmedien in der medizinischen Mikrobiologie und spielt eine zentrale Rolle bei der Identifikation von Bakterien.
- Einführung:Mikrobiologie leicht erklärt: Nährmedien, ihre Typen und Anwendungen
- Blutagar einfach erklärt – Aufbau, Hämolyse und Anwendung
- MacConkey Agar erklärt: Selektiv- und Differentialmedium für gramnegative Bakterien
- Kochblutagar einfach erklärt: Optimalmedien für anspruchsvolle Erreger
- CLED Agar in der Urindiagnostik einfach erklärt
Wie im letzten Beitrag versprochen, stelle ich euch heute eines der wichtigsten Nährmedien in der medizinischen Mikrobiologie vor. Wer sich vorab noch einmal einen Überblick zu den verschiedenen Nährmedien verschaffen möchte, kann gern in meinen Artikel „Mikrobiologie leicht erklärt: Nährmedien, ihre Typen und Anwendungen“ schauen.
Blutagar
Diesmal geht es um den Blutagar. Und davon gibt es nicht nur eine Variante, sondern gleich mehrere. Blutagar enthält, wie der Name schon vermuten lässt, neben den üblichen Nährstoffen auch Blut. Meistens wird dafür Schafblut verwendet, manchmal aber auch Pferdeblut.
Doch wozu braucht man eigentlich Blut in Agarplatten?
Viele Bakterien bilden bestimmte Toxine, sogenannte Hämolysine. Diese Stoffe können die Zellwand von roten Blutkörperchen zerstören. Genau das macht man sich in der Diagnostik zunutze, denn anhand dieser Eigenschaft lassen sich verschiedene Bakterien voneinander unterscheiden. Natürlich kann man so nicht jedes Bakterium eindeutig identifizieren, aber man kann Gruppen von Bakterien gut voneinander abgrenzen und das ist ein wichtiger erster Schritt in der mikrobiologischen Untersuchung.
Auf Blutagar kann man gut beobachten, wie sich Bakterien gegenüber den roten Blutkörperchen verhalten, also ob und wie stark sie das enthaltene Blut abbauen und Hämolysine bilden, die die Zellmembran der Erythrozyten angreifen und zerstören. In der medizinischen Mikrobiologie unterscheidet man drei Formen der Hämolyse: alpha, beta und gamma. Der Name „gamma-Hämolyse“ ist dabei etwas irreführend, denn hier findet eigentlich keine Hämolyse statt.
Hämolyse
α-Hämolyse
Bei der α-Hämolyse handelt es sich um eine unvollständige Hämolyse. Die Bakterien produzieren keine Hämolysine, also keine Stoffe, die rote Blutkörperchen direkt auflösen können. Stattdessen werden die roten Blutkörperchen durch Stoffwechselprodukte der Bakterien, meist Wasserstoffperoxid (H2O2) oder Schwefelwasserstoff (H2S), chemisch verändert. Dabei wird das im Blut enthaltene Hämoglobin zu Methämoglobin oder zu grünlich schimmerndem Sulfhämoglobin umgewandelt. Diese Umwandlung färbt den Nährboden im Bereich der Kolonien leicht grünlich, was typisch für die α-Hämolyse ist.
Bakterien mit diesem Verhalten, wie zum Beispiel Streptococcus pneumoniae, besitzen im Gegensatz zu β-hämolysierenden Arten keine Hämolysine oder Hämoxygenasen und können Hämoglobin daher nicht vollständig abbauen.
β-Hämolyse
Bei der β-Hämolyse ist das anders. Hier werden die Erythrozyten vollständig aufgelöst, und auch das freiwerdende Hämoglobin wird vollständig abgebaut, man spricht deshalb von einer „echten“ Hämolyse. Verantwortlich dafür sind zum Beispiel Enzyme wie Streptolysin O (sauerstoffempfindlich) und Streptolysin S (sauerstoffstabil), die als Exotoxine wirken und rote Blutkörperchen gezielt lysieren. Im Labor erkennt man β-hämolysierende Bakterien an einem klar durchscheinenden Bereich rund um die Kolonien, in dem alle Erythrozyten zerstört sind.
Und welche Bakterien bilden nun β-Hämolyse?
Es gibt einige spannende Beispiele und genau die schauen wir uns jetzt an.
Zu den bekanntesten Vertretern β-hämolysierender Bakterien gehören Streptococcus pyogenes und Streptococcus agalactiae. Beide Arten zeigen auf Blutagar eine deutlich ausgeprägte Hämolyse. Bei S. pyogenes sind die Toxine Streptolysin O und Streptolysin S für die Auflösung der roten Blutkörperchen verantwortlich, während S. agalactiae ein β-Hämolysin/Cytolysin bildet, das einen ähnlichen Effekt hat.
Zum Abschluss gibt es hier noch eine kleine Übersicht über weitere Vertreter hämolysierender Bakterien.
Bakterium | Typ der Hämolyse | Beispiele für Hämolysine / Toxine |
|---|---|---|
Streptococcus pyogenes (Gruppe A) | β-Hämolyse | Streptolysin O, Streptolysin S |
Streptococcus agalactiae (Gruppe B) | β-Hämolyse | β-Hämolysin/Cytolysin |
Staphylococcus aureus | β-Hämolyse | β-Hämolysin |
Escherichia coli (hämolytische Stämme) | β-Hämolyse | HlyA, EhxA |
Listeria monocytogenes | β-Hämolyse | Listeriolysin O |
Clostridium perfringens | β-Hämolyse | α-Toxin (Phospholipase C), Perfringolysin O |
Bacillus cereus | β-Hämolyse | Cereolysin |
Vibrio vulnificus | β-Hämolyse | VvhA (Vibrio-Hämolysin) |
Haemophilus ducreyi | β-Hämolyse | Hämolysin Dly |
Und welche Bakterien bilden α-Hämolyse?
Nachdem wir uns die β-Hämolyse genauer angesehen haben, darf die α-Hämolyse natürlich nicht fehlen. Hier gibt es einige spannende Vertreter, die sich durch ihr charakteristisches grünliches Hämolysebild erkennen lassen.
Der bekannteste Vertreter der α-hämolysierenden Bakterien ist Streptococcus pneumoniae. Neben der typischen grülichen Hämolyse auf Blutagar bildet S. pneumoniae oft auch leicht schleimige Kolonien, was auf seine ausgeprägte Kapselbildung zurückzuführen ist.
Zur α-Hämolyse gehört außerdem die Gruppe der sogenannten vergrünenden Streptokokken, auch bekannt als Viridans-Gruppe. Der Name leitet sich übrigens vom lateinischen viridis für „grün“ ab. Zu dieser Gruppe zählen unter anderem Streptococcus anginosus und und Streptococcus mitis. Weitere Kandidaten sind S. mutans und S. salivarius.
Wie zu Beginn schon erwähnt, gibt es verschiedene Arten von Blutagar. Drei davon möchte ich euch heute etwas genauer vorstellen. Die genaue Zusammensetzung kann je nach Hersteller natürlich leicht variieren.
Columbia Agar
Zusammensetzung
- Pankreatisch abgebautes Casein
- Peptisch abgebautes Tiergewebe
- Hefeextrakt
- Rindfleischextrakt
- Maisstärke
- Natriumchlorid
- Agar
- 5% defibriniertes Schafblut
Der Columbia Agar gehört zu den Universalmedien. Das bedeutet, dass darauf praktisch alle medizinisch relevanten aeroben Erreger wachsen können, sogar Pilze. Er dient also als Übersichtsmedium, mit dem man sich einen ersten Eindruck davon verschaffen kann, welche Mikroorganismen in einer Probe enthalten sind. Durch das enthaltene Schafblut kann man auch das Hämolyseverhalten der Erreger bestimmen.
CNA (Colistin/Nalidixinsäure) Agar
Zusammensetzung
- Peptonmischung
- Stärke
- Natriumchlorid
- Nalidixinsäure
- Colistin
- Agar
- 5% defibriniertes Schafblut
Der CNA Agar ist ein Selektivmedium. Durch den Zusatz der Antibiotika Colistin und Nalidixinsäure wird das Wachstum gramnegativer Bakterien weitgehend gehemmt. Dadurch lässt sich das Hämolyseverhalten insbesondere von grampositiven Kokken besser beurteilen. Zusammen mit den morphologischen Eigenschaften der Kolonien kann man so bereits eine erste Einschätzung zurückzuführen Identifizierung treffen.
Müller Hinton Agar mit Pferdeblut
Zusammensetzung
- Pepton
- Casein-Hydrolysat
- Ca2+ , Mg2+
- Agar
- 5% Pferdblut
- beta NAD (Nicotinamidadenindinukleotid)
Die spannende Frage ist hier natürlich, warum beim Müller Hinton Agar Pferdeblut und nicht Schafblut verwendet wird. Der Müller Hinton Agar wird hauptsächlich für Antibiotikatestungen eingesetzt, zum Beispiel bei der Agardiffusion oder beim E Test. Diese Anwendung wird auch von EUCAST ausdrücklich empfohlen.
Aber was macht Pferdeblut in diesem Zusammenhang so besonders?
In der Empfindlichkeitsprüfung bakterieller Erreger gegenüber Antibiotika wird häufig lysierter Pferdeblutagar eingesetzt, um verlässlichere Ergebnisse insbesondere bei Trimethoprim und Sulfonamiden zu erhalten. Viele herkömmliche Nährböden enthalten nämlich geringe Mengen an Thymidin, das die Wirkung bestimmter Antibiotika abschwächen oder sogar aufheben kann. Beim Lysieren von Pferdeblut wird aus den roten Blutkörperchen das Enzym Thymidinphosphorylase freigesetzt. Dieses wandelt Thymidin in Thymin um, das deutlich weniger störend auf die Antibiotikawirkung reagiert. Schafblut enthält dieses Enzym hingegen nicht und genau deshalb ist Pferdeblut für diese Art von Testungen die bessere Wahl. Außerdem finden auch anspruchsvollere Bakterien wie Haemophilus influenzae oder verschiedene Streptokokken auf diesem Nährmedium optimale Wachstumsbedingungen.
Rein äußerlich lassen sich die drei Agararten nicht voneinander unterscheiden. Im Labor ist also Aufmerksamkeit gefragt, damit man immer den richtigen Agar verwendet. Zum Glück sind alle Platten vom Hersteller deutlich beschriftet, sodass Verwechslungen leicht vermieden werden können.
So habt ihr jetzt einen guten Überblick über die gängigsten Blutagar und deren Einsatzmöglichkeiten erhalten. Schaut auch gern einmal bei meinen anderen Blogbeiträgen vorbei. Ich habe zum Beispiel eine spannende Reihe zum Thema Antibiotikaresistenzen geschrieben.
Und wenn du noch mehr Lust auf Mikrobiologie bekommen hast, dann schau dir doch mal mein tolles Quizbuch an.